Tagung 2007
Tagung 2007 vom 1. bis 3. November 2007 in Berlin
Museum für Kommunikation
"Eine Standortbestimmung: Drucktechnik als Teil der Kommunikations- und Mediengeschichte"
Programm der Tagung als PDF zum Download

Das Museum für Kommunikation in Berlin
Das ehrwürdige Gebäude an der Ecke Leipziger-/Mauerstraße in Berlin-Mitte wurde 1872 auf Initiative des Generalpostmeisters Heinrich von Stephan gegründet und gilt als das älteste Postmuseum der Welt. Der wilhelminische Prunkbau entstand in den Jahren 1893 bis 1897 nach Plänen des Postbaurats Ernst Hake. Während des Zweiten Weltkriegs wurde das Haus geschlossen und die Exponate in Thüringer Kalisalzbergwerke ausgelagert. 1943 bis 1945 trafen schwere Bomben das Gebäude. Nach Kriegsende war es deshalb lange Zeit Ruine. 1958 konnte es als Postmuseum der DDR behelfsmäßig wiederhergerichtet werden. Beinahe wäre es der Spitzhacke zum Opfer gefallen. Im Zuge der Trendwende in der Geschichtsauffassung der DDR-Regierung wurde 1981 beschlossen, das Gebäude in seinem ursprünglichen Erscheinungsbild wiederherzurichten. 1987 konnte es einigermaßen restauriert wiedereröffnet werden. Nach dem Mauerfall kam das Museum in den Verwaltungsbereich der Deutschen Post, die das Gebäude weiter restaurieren ließ. Mit der Zweiten Postreform ging es in das Eigentum einer Stiftung über, der auch die Postmuseen in Hamburg, Frankfurt-Main und Nürnberg, sowie das Archiv für Philatelie in Bonn unterstehen. Sie wurden im Zuge der Ausweitung der neuen Dienste in „Museum der Kommunikation“ umbenannt. Kuratorin der Museumsstiftung Post und Telekommunikation sowie Direktorin des Museums in Berlin ist Frau Dr. Lieselotte Kugler, die auch dem IADM-Vorstand angehört.

Neben der Entwicklung der Postdienste und der Telekommunikation sind 40 000 Briefmarken, sozusagen kleinste Druckobjekte, im Museum zu bewundern. Eines der wertvollsten Stücke ist dabei die „Blaue Mauritius“, der Fehldruck einer Briefmarke, die einen Brief in der Schatzkammer des Museum im Untergeschoss ziert Nach dem Zweiten Weltkrieg war das kostbare Stück verschollen. 1976 wurde es in Philadelphia zum Verkauf angeboten, worauf sich die US-Zollbehörde einschaltete und den wertvollen Brief in Verwahrung nahm. Bis zur Wiedervereinigung stritt man sich auf internationaler Ebene, ob der Brief der DDR oder der BRD gehöre. Mit dem Mauerfall kehrte das unscheinbar aussehende Stück an seinen ursprünglichen Aufbewahrungsort zurück und ist seitdem von jedermann in einer durchsichtigen Panzerglassäule zu besichtigen. Sie befindet sich dort neben dem ersten Telefon des Friedrichsdorfer Physiklehrers Philipp Reis von 1861, der Braunschen Röhre von 1897 und anderen Kostbarkeiten.
Beim Rundgang in den insgesamt 3 Etagen sieht man schon im Parterre Roboter mit Haushaltsgeräten zirkulieren, die die Zukunft andeuten. Im obersten Stockwerk findet dies seine Fortsetzung mit der Ausstellung zum Thema Globalisierung. In 12 Stationen werden dabei Dinge wie der weltweite Blumenhandel und das Versenden von Nordseekrabben zum Auspulen nach Portugal kritisch hinterfragt. Auf dem Weg dorthin kommt man an einer spektakulär aufgehängten Postkutsche vorbei, an Postsäulen, historischen Briefkästen, Schreib-Petschaften und Brief-Siegeln, der ersten Schreibmaschine, einer Galerie von Telegraphen bis zur geheim schreibenden Enigma, einer zweiten Galerie von Telefongeräten bis zum modernen Handy, den ersten Rundfunksendern, den ersten Fernsehkameras. Der Druck wird mit Zeitungen demonstriert, die einmal von der Post herausgegeben wurden.
Die Druckgeschichte ist Teil der Mediengeschichte
Auch wenn die Mediengeschichte in ihrer Vielfalt und Komplexität, der Schnelligkeit des Wechsels und der Verborgenheit ihrer Strukturen schwerer als die Druckgeschichte zu erklären ist, so sollte uns dies nicht davon abhalten, uns als Teil von Ersterer zu verstehen. Ob Schrift, Bild, Ton oder Film, auf Substraten oder mit elektronischen Mitteln analog oder digital gespeichert, ob als Hard Copy oder über elektromagnetische Wellen verteilt – alles dient dem gleichen Zweck: den Mitmenschen zu informieren, ihm Hilfen im Alltag zu geben und/oder in seiner Freizeit zu unterhalten. Die Standortbestimmung, zu der die Mitglieder des IADM am 2. und 3. November 2007 im Museum für Kommunikation in Berlin zusammengekommen waren, wurde zwar kontrovers diskutiert, doch im Grundsatz der Zugehörigkeit war man sich einig.
Nachfolgend finden Sie die Zusammenfassungen der Vorträge. Kurzsfassungen bzw. die kompletten Vorträge zum Download werden in Kürze ergänzt.

Boris Fuchs zeigte gleich zu Anfang in einer Zeitleiste auf, wie sich die Drucktechnik schon in den frühen Anfängen des Mittelalters entwickelt hat, als die Kommunikationstechnik sich noch mit Signalfeuern und Rauchtelegrafen in ihren ersten Kinderschuhen befand. Später verschmolzen elektronischer Kommunikationsmittel immer mehr mit der Drucktechnik, sodass man von einem symbiotischen Miteinander sprechen kann. Heute laufen alle Vorstufenprozesse der Drucktechnik elektronisch ab – nur noch der Druck erfolgt konventionell und zum Teil auch elektronisch mit Ink-jet und Laserdruck.
Der Vortrag von Boris Fuchs als Download

Prof. Dr. Gundolf S. Freyermuth von der Internationalen Filmschule in Köln (ifs) postulierte in seinem Referat über „Das obskure Objekt digitaler Begierde – von der doppelten Zukunft des Buches“ die Tatsache, dass jedes neue Medium, das im Lauf der Geschichte entstand, sich der Schriftlichkeit bedient habe. Mit der Digitalisierung entstand jedoch eine Aufhebung der tradierten analogen Medienvielfalt und Hinwendung zu Transmedien. Er sprach der vollkommenen Freiheit der Publikation das Wort („Copyright is out“), indem digitale Transmedien die technologischen Grenzen beseitigen, die zeitliche Unabgeschlossenheit akzeptieren und neue Kollaborationen der Verfasser ermöglichen. Es entstehe dadurch eine Universal-Bibliothek, wie sie Kevin Kelly vorausgedacht habe. Insofern spreche er von der doppelten Zukunft des Buches als der Welt eines einzigen Buches, das aber sehr, sehr dick ist. Die Sicherheit des Bestandes sei durch die weite Streuung der Inhalte gegeben und es werde eher erforderlichen, „Datenvergessensmaschinen„ einzuführen, um der überbordenden Datenflut Herr zu werden.

Eine ganz andere Position nahm Markus Dreesen von der Culturetainement GmbH, einer Medien-Agentur in Teltow, bei seinem Referat „Qualitätsdruck im Zeichen der Neuen Medien“ ein. Er stellte fest, dass 71,2% der Bundesbürger online erreichbar sind, 32% davon suchen aktuelle Nachrichten im Netz, 60% davon nutzen das Netz für den Einkauf und ein Großteil sucht soziale Kontakte darin. Doch 78% sagen, dass die gedruckte Zeitung für sie unverzichtbar sei und sie längere Nachrichten nicht „scrollend“ lesen wollen. 25 % glauben, dass die Zeitung noch an Bedeutung gewinnen werde. Der Büchermarkt boomt, wie das jüngste Beispiel der Harry-Potter-Romane gezeigt habe. Die Fronten, die aufgebaut werden, stimmen nach seiner Meinung nicht. Jedes Medium ist für seinen Bedarf optimal ausgelegt. Im sozialen Netzwerk des Web hinterlassen die Anwender Spuren, sodass gezielter geworben werden kann. Doch was sucht der User im sozialen Netzwerk? Er will vor allem Texte schreiben und Fotos herunterladen und Freunden im Netz zeigen. Dabei ist die Qualität des Bildes entscheidend. Diese Bilder will er dann zusätzlich auch auf Papier festhalten und dabei genügt ihm nicht der billige PC-Ausdruck. Er will sie professionell angefertigt haben und ist bereit, dafür auch mehr zu bezahlen. Insofern sollten die Neuen Medien als Herausforderung für kreative Lösungen angesehen werden. Das sei die Zukunft!

Karl-Heinz Kaschel-Arnold von der Gewerkschaft ver.di in München hatte es übernommen über Arbeitsbedingungen in den androgynen Medien zu sprechen. Die Bezeichnung „androgyn = zweigeschlechtig habe er selbst erfunden. Der neue Typus sei entstanden, da die klassischen Grenzen überschritten wurden. Mit dem Copyright entstehen Probleme, wenn das geistige Eigentum des Autors in verschiedene Veröffentlichungskanäle fließe. Wegen neuer Geschäftsfelder werde in der Kernredaktion immer mehr Personal abgebaut. Gleichzeitig treten neue Anbieter auf – das Produktionsmonopol der Druckindustrie ist ein für alle Mal verloren. Diese wehrt sich mit immer leistungsfähigeren Maschinen, was weiter Personal freisetzt. Die sozialen Folgen hat die Allgemeinheit zu tragen. Wie müssen Gewerkschaften damit umgehen? Sie müssen vor allem auf neue Berufsbilder drängen. So der Mediengestalter für Digital und Print. Rund 55% der Mediengestalter werden außerhalb der Druckindustrie eingesetzt mit Gehältern 50% niedriger als nach Tarif, aber gestiegener psychischer Belastung. Auch die Arbeit in androgynen Medien braucht soziale Leitplanken. Die Gewerkschaft sucht dies jetzt auf europäischer Ebene zu lösen.

Dr. Dr. Hartmuth Herbst von der Deutschen Arbeitsschutzausstellung (DASA) in Dortmund eröffnete den Reigen der Museums-Referenten, die sich als Druckmuseen der neuen Medienvielfalt gegenübergestellt sehen. Die DASA untersteht dem Bundesministerium für Arbeit und soll die Öffentlichkeit über Arbeitssicherheit gestern und heute aufklären. Nach einem Abriss der Technikgeschichte zeigte Dr. Herbst die Zielsetzungen einer Sonderausstellung, die sich mit neuen Arbeitsinhalten und der persönlichkeitsfördernden, belastungsschonenden, individuellen Leistungsgestaltung beschäftigt. Dies trifft für die gesamte Medienwelt zu. Ganz neue Ansprüche werden an die interkommunikativen Fähigkeiten (Teamgeist) des Menschen gestellt. Der Mensch muss trotz Automatisierung und Termindruck Maß aller Dinge bleiben. Wissen und Kreativität sind gefragt. Dazu kommt die Notwendigkeit eines lebenslangen Lernens.
Der Vortrag von Hartmuth Herbst als Download

Dr. Roger Münch vom Deutschen Zeitungsmuseum in Wadgassen informierte über die Planung eines neuen Museums für Kommunikation im Saarland. Er habe sich schon immer darüber gewundert, dass die CECOMM = Conference of European Communications Museums die Druckmuseen nicht als Kommunikations-Museen angesehen haben. Wenn man heute ein Handy in die Hand nehme, dann könne man etwas überspitzt sagen, das sei kein Telefon, sondern eine Zeitung. Mobile Publishing ist heute ein viel zitiertes Schlagwort.. Bei der Konzeption des neuen Museums für Kommunikation im Saarland ging man von der Fragestellung aus: Wie haben wir gestern kommuniziert, wie tun wir dies heute und wie werden wir dies in Zukunft tun? Der Lernort wird dabei das aktive Erleben sein, das Mittun des Besuchers. Um die Kosten niedrig zu halten hat man ein leer stehendes Aldi-Gebäude in einer Gemeinde – der Name wird noch nicht bekannt gegeben – gekauft. Grundstock der der Exponate wird die Sammlung eines Privatmannes sein. Es wird Kernmodule (Dauerausstellung) und Randmodule (Wechselausstellungen) und die klassischen trägerorientierten Medien, die klassischen Übertragungsmedien, Multimedia sowie die Netzte umfassen.
Der Vortrag als Download

Dr. Stephanie Jacobs vom Deutschen Buch- und Schriftmuseum in der Nationalbibliothek Leipzig informierte über einen Neubau, in dem sie die Mediengeschichte anhand der drei Medien-Innovationen „Übergang zur Schriftlichkeit und Mündlichkeit“, „Die Entstehung des Buchdrucks“ und „Die digitale Welt“ erklären wird. Sie will diese drei Strömungen dabei der Kritik der Besucher aussetzen, ausgehend von Platos Kritik an der Schrift, weil diese den Verlust des Gedächtnisses zur Folge habe. 2500 Jahre danach sollte sich daraus ein spannendes Moment ergeben.
Der Werkstatt-Bericht als Word-Datei zum Download

Dr. Susanne Richter vom Werkstattmuseum für Druckkunst in Leipzig hat erst kürzlich die Leitung dieses Museums übernommen und konnte deshalb nur eine Bestandsaufnahme präsentieren, die die Geschichte des Museums, die Sammlung, die Besucherzahlen, die Ausstellungen, die Museumspädagogik, Veranstaltungen, Messeauftritte, Drucksachen, den Museumsshop und einen Ausblick umfasste. Unter Letzterem setzte sie als Ziele: Festigung der Position in der Leipziger Museumslandschaft, Weiterentwicklung der Sammlung, verstärkte Zusammenarbeit mit Künstlern und Designern, Fortführung der Ausstellungstätigkeit und Kooperation mit (Bildungs-) Institutionen in der Region.
Der Werkstatt-Bericht als Download

Dr. Harry Neß, der Vorsitzende des IADM, fasste am Schluss das Gesamtthema „Standortbestimmung: Druckgeschichte als Teil der Kommunikations- und Mediengeschichte“ zusammen. Er erklärte, dass die Mediengeschichte sehr schwierig zu greifen sei, da die zu analysierenden technisch-naturwissenschaftlichen Prozesse im digitalen Zeitalter einen hohen Abstraktionsgrad haben und nur mit einem sehr großen theoretischen Kenntnisvorrat von Laien zu verstehen seien. Doch es gebe in der Mediengeschichte einen hohen Nachholbedarf, die mehr die elektronischen und weniger die Printmedien im Auge habe. Darin liege zukünftig eine wichtige Aufgabe für den IADM, den Kommunikationsprozess der Archivierung, Forschung und Präsentation mit gegenseitigem Respekt und gegenseitiger Offenheit in die gesellschaftliche Wirklichkeit hinein zu organisieren und zu stützen.
Der Vortrag von Harry Neß als Download
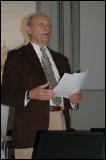
Fotos: Sascha Boßlet & Boris Fuchs
Texte: Boris Fuchs
(C) 2011 - Alle Rechte vorbehalten